Lektüren
Zweimal Charles Taylor
14.09.
U. a. Taylor für unterwegs mitgenommen (den stw-Band „Negative Freiheit“). Jetzt zwei Stücke gelesen, das titelgebende „Der Irrtum der negativen Freiheit“ und „Bedeutungstheorien“. Reaktion: Ja, aber nicht so. Wobei das Ja ein gebrochenes ist, und das aber nicht so in gewisser Weise auch. Und das bezieht sich im Grunde auf den ganzen Taylor.
Ja
Taylor ist dazwischen, ohne zwangsläufig mittig oder gemässigt zu sein (wobei er das im Resultat dann doch am ehesten ist), und aufgrund dieses Dazwischen bin ich zu ihm hingezogen, ursprünglich durch seine religionsphilosophischen Sachen (Säkulares Zeitalter und Formen des Religiösen). Er ist dazwischen, was Religion angeht, als Antimetaphysiker, aber Katholik; er ist politisch dazwischen, als Kommunitarist, der weder Individual-Liberaler noch linker Kollektivist ist (obwohl er eine bestimmte „bessere“ Form des Liberalismus verteidigt und sich selbst sicherlich als „links“ sieht), und er ist auf allerlei Weise persönlich und intellektuell dazwischen, als zweisprachiger Kanadier, als Philosoph, der einerseits mehr oder weniger analytische Philosophie betreibt, aber mit einer kontinentalen, hermeneutischen, existenzialen Stossrichtung. Und dieses Dazwischensein äussert sich natürlich auch in diesen beiden Stücken.
Was er in dem Freiheits-Text macht, finde ich grundsätzlich sehr richtig, und man kann es auch sehr aktuell lesen (als eine Ermahnung an den Liberalismus, nicht in den Libertarianismus abzugleiten – wobei die andere Tendenz eines anderen derzeitigen Liberalismus, die Paternalisierende, nicht besser ist). Er knüpft an an Isaiah Berlins Unterscheidung zwischen Freiheit von und Freiheit für und argumentiert (sehr detailliert, zu detailliert), dass Freiheit von nicht genug ist und sich auch als theoretische Position nicht durchhalten lässt. Das tut er nicht praktisch-politologisch (etwa so, dass eine Absolutsetzung der Freiheit von zu Anarchie, Chaos und sozialem Krieg führt, was sicherlich der Fall ist), sondern ausgehend von seinem Zentralprojekt, seiner philosophischen Anthropologie, die um seinen spezifischen „Taylorschen“ Subjekt-Begriff kreist.
Charakteristisch für dieses Subjekt ist zweierlei: dass es eine Meta-Subjektivität beinhaltet und dass es sozial vermittelt ist. Die Meta-Subjektivität macht Taylor an Harry Frankfurt fest: Der Mensch hat nicht nur Wünsche, sondern auch Wünsche über Wünsche – er kann kann zum Beispiel wollen, Dinge nicht zu wollen, die er will. Etwa kann er wünschen (oder wollen), nicht rauchen zu wollen, obwohl er starker Raucher ist.
Dieses Meta-Wünschen ist sicherlich etwas spezifisch Menschliches (-> Anthropologie), aber es ist noch zu wenig für echte Subjektivität, es muss das Werten hinzukommen, und zwar das Werten von Bewertungen, also auch hier das Meta-Werten. Wir bewerten unsere Wünsche nach Relevanz, und manche – grob gesagt: die ethischen – halten wir für relevanter als andere (grob gesagt: die egoistischen).
Diese Fähigkeit, Werte zu bewerten (Taylor schreibt in einem anderen Text von hypervalues), ist entscheidend dafür, im Vollsinne ein menschliches Subjekt zu sein, und sie ist gebunden an die Sozialität des Menschen, sein Teil-Sein von einer Gemeinschaft, einer Kultur. Ein isoliertes Subjekt, ein reiner Ich-Punkt, hätte keine Fähigkeit zur Meta-Wertung, ihm würden alle Anhaltspunkte dafür fehlen, alle Valorisierungs-Dispositive, die sich nur sozial konstituieren können. Das ist der Kern von Taylors Subjekt-Theorie (Quellen des Selbst), und ich halte sie grundsätzlich für überzeugend, auch wenn sie bei Taylor Konsequenzen hat, bei denen ich nicht mitgehen würde (z. B. sein Antinaturalismus).
Was er dann aber mit diesem Subjekt-Begriff in Hinblick auf die Freiheit macht, finde ich seltsam, überkompliziert und letztlich durchschlagsschwach.
Er argumentiert zunächst, dass ein Verständnis von Freiheit, das sich ausschliesslich als Freiheit von (materiellen Hindernissen, überflüssigen staatlichen Regelungen usw.) versteht, in die isolierte Indivdualität hineinführt, die Meta-Werten und eigentliches Subjekt-Sein unmöglich macht.
Dabei gibt es eine interessante Seitenlinie, die nicht äussere, sondern innere Freiheitshindernisse betrachtet: Wenn ein Mensch mit Wünschen oder vielleicht eher Impulsen ausgestattet ist, die er nicht haben will, etwa mit Neid oder Groll, dann hilft ihm eine libertär verstandene äussere Hindernis-Freiheit (Taylor nutzt das Wort „libertär“ nicht) wenig dabei, diese Wünsche loszuwerden, sie macht ihn also nicht frei.
Den Hauptschlag gegen eine Verabsolutierung der negativen Freiheit (der Freiheit von) setzt Taylor aber über die Beobachtung, dass es falsche Wünsche und falsche Werte gibt, dass man sich also selbst in seinem Meta-Werten irren kann: Terroristen wie Charles Manson oder Andreas Baader hätten ihre eigene Relevanzordnung des Wertens aufgestellt, und zwar aus negativer Freiheit (nichts und niemand hat sie daran gehindert, zu einer solchen Wertordnung zu gelangen), aber diese „Wertordnung“ sei ein Irrtum, im Grunde (meine Worte) eine Perversion. Solchen Perversionen des Wertens stehe aber die negative Freiheit hilflos gegenüber, und deshalb sei sie keine Freiheit.
Es ist dieses letzte, was mich irritiert und wo ich denke, man muss anders abzweigen. Taylor macht im ganzen Text immer wieder Anläufe, eine positive Freiheit, eine Freiheit zu gegenüber der negativen Freiheit stark zu machen, aber sie bleibt eigentümlich blass und unvollendet. Sicher, das kann damit zusammenhängen, dass der Text älteren Datum ist (1983), also vor den Quellen des Selbst und dem Unbehagen in der Moderne entstanden ist, und Taylor daher hier erst andeutend auf Konzeptionen hinarbeitet, die später dann konkreter werden.
Ich lese seine Vorstösse in diesem Stück hier jedenfalls so, dass er eine positive Freiheit, die er immer wieder etwas irreführend Freiheit der „Selbstverwirklichung“ nennt (wohinter natürlich seine Idee von – sozial vermittelter oder bedingter – Identität steht, die das Subjekt braucht, um sich zu konstituieren), letztlich als einen ethischen oder ethisch mündigen Umgang mit der positiven Freiheit verstehen will. Also in der Art, dass die wahre Freiheit darin besteht, innerhalb der von der negativen Freiheit eröffneten Möglichkeiten ethisch, verantwortungsvoll, sozialverträglich, vielleicht auch auf Transzendenz hin orientiert zu handeln. (Interessant übrigens, dass Taylor Transzendenz bejaht, Metaphysik verneint – ja, in diese Zwickmühle kann man die Moderne spannen!)
Das ist ein sehr starker, sehr reicher, und ich finde, ein übersättigter Freiheitsbegriff, den Taylor da konstruiert. Sicher, man kann ihn nachvollziehen. „Mündige Freiheit“ fände ich immer noch die beste Umschreibung (ich glaube, Taylor nutzt sie nicht und auch nichts vergleichbares). Aber ist das „mündig“ darin wirklich ein Teil von Freiheit, sein positiver Teil, ist es das „zu“ in Freiheit zu? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eher eine freiwillige Einschränkung von (negativer) Freiheit. Natürlich kann man im „freiwillig“ dann wieder einen Aspekt der Freiheit erkennen. Dennoch empfinde ich es als eine Überfrachtung des Freiheitsbegriffes, die letztlich nichts bringt.
Denn man muss sich ja immer fragen, oder jedenfalls frage ich mich das: Welche Wirkung kann eine Arbeit am Begriff haben? Könnte der neu gedeutete, neu geklärte, neu aufgeladene Begriff in dieser oder ähnlicher Form ins allgemeine Denken eingehen? Werden Politiker, die von Freiheit reden, demnächst Freiheit so verstehen – als die Freiheit, seine Freiheit ethisch einzusetzen, die Freiheit, auf Freiheit zu verzichten? Ich zweifle daran. Der Kern aller Freiheitskonzepte ist die Abwesenheit von Hindernissen, das nicht-Gängeln, das nicht-Bevormunden, und trotz aller Probleme, die ein solches Konzept mit sich bringt, gerade in der bisherigen Entfaltung der Moderne, wird das auch so bleiben. Denn man kann zwar einen Begriff umakzentuieren, aber nicht seinen Kern an eine andere Stelle versetzen.
Und das muss man auch nicht, vor allem dann nicht, wenn bessere Alternativen bestehen. Und hier denke ich, es gibt sie, sie liegen auf der Hand, und ich habe mich während der Lektüre zunehmend gefragt, warum Taylor sie nicht ergreift.
Die eine Alternative ist natürlich die Beschränkung der (negativen) Freiheit durch das Gesetz, aber sie ist so offensichtlich und – in Hinblick auf Taylors anthropologisches Projekt – so „unphilosophisch“, dass es verständlich ist, dass Taylor sie links liegen lässt. Das Gesetz konstituiert nicht das Subjekt. Manson und Baader handelten gegen das Gesetz und richteten sich ihr Meta-Werten antigesetzlich ein, aber sie erlebten das im Rahmen ihrer jeweils eigenen Subjektivität als „richtig“. Ihren Subjektivitäten gegenüber war das Gesetz machtlos.
Bei der anderen Alternative wundert es mich mehr, dass Taylor sie nicht in Betracht zieht, zumal er sich ja in vielem als Aristoteliker versteht. Diese andere Alternative ist die Weisheit. Denn dass die Meta-Wertungen und das Handeln von Manson oder Baader in allhöchstem Masse unweise, Weisheitslos, weislos sind, das zumindest, denke ich, liegt ja auf der Hand.
Sicher, „Weisheit“ hat heute einen seltsamen Klang, allerdings auch nicht in allen Zirkeln, noch nicht einmal in allen wissenschaftlichen oder progressiven, es gab geradezu ein Revival des wisdom-Diskurses vor einigen Jahren, allerdings scheint es wieder ein wenig eingeschlafen zu sein. Aber sowieso sollte man sich von einem „seltsamen Klang“ nicht schrecken lassen, wenn dafür der Kern des Wortes intakt ist und brauchbar zu sein verspricht.
„Weisheit“ lässt sich, als Begriff oder Begriffsinhalt, nicht, wie Taylors positive Meta-Freiheit (das ist es übrigens eigentlich, wovon er redet: von Meta-Freiheit) aus theoretischen Überlegungen ableiten, jedenfalls nicht aus theoretischen Überlegungen zur sozial konstituierten Subjektivität. Weisheit muss – als Begriff – zunächst gesetzt werden, in Sinne einer Behauptung, etwa: Freiheit (negative Freiheit) allein führt ins Desaster, wenn mit ihr nicht weise umgegangen wird.
Und dieses weise, diese Weisheit wäre dann zum einen als eine persönliche Qualität („Tugend“) zu verstehen, zum anderen als eine politische. Und sie wäre nach ihrer Setzung mit Inhalt zu füllen (Was ist Weisheit? Was ist weises Handeln?). Und sie wäre zum einen natürlich ein Ideal (also nichts, das immer von vorn herein Teil der Subjektivität ist, aber das ist Taylorsches Meta-Werten auch nicht), sie wäre andererseits aber auch, ganz wie Taylors positive Freiheit, etwas, das im Eingebettetsein des Subjekts in seine Gemeinschaft existiert – sie wäre also kompatibel mit dem Kommunitarismus, den Taylor als politisches Dazwischen (zwischen Libertarianismus und Kollektivismus) vertritt.
Nein
Jetzt bin ich natürlich schon längst beim nein, bzw. bei der Verschränkung von ja und nein, bzw. beim nein-sondern. Das sondern ist jetzt hier erst einmal so hingeworfen, aus der aktuellen Leseerfahrung heraus, natürlich ist auch die Weisheits-Alternative zunächst ein wenig „naiv“ (quasi-naiv, schein-naiv), es ist schlicht die Richtung, in die ich in diesem Zusammenhang denken würde – und der Zusammenhang ist durchaus ein dringender, wenn man die aktuelle Krise, nein, Plural: die aktuellen Krisen des Liberalismus betrachtet.
Mein nein, bzw. mein Ja, aber nicht so entzündete sich aber noch an etwas anderem, eher methodischen, das allerdings auch einen Teil der Verantwortung für die Schwäche der Taylorschen positiven Freiheit trägt. Dieses andere klang eben schon an, es ist der Deduktionismus.
Taylor ist, trotz seiner kontinentalen Vorlieben, ein angelsächsischer Philosoph, und er ist, trotz seinem Antinaturalismus, ein szientistischer Philosoph, im Sinne einer Philosophie, die ihre Themen durchargumentiert (oder diesen Anspruch hat) und alle ihre Argumente technisch-rational begründet (oder das versucht). (Ich setze das „technisch“ vor das „rational“, weil ich meine, dass es auch andere Formen von Rationalität gibt).
Und dieser technisch-rational-angelsächsiche Deduktionismus hat seine Nebenwirkungen. Er führt einmal ganz banal zu fürchterlich langen Texten (ich möchte bei Taylor, so sehr ich ihn schätze, immer händeklatschend danebenstehen und rufen: schneller! schneller!), er führt aber vor allem zu etwas, das ich verzagtes Denken nennen würde. Taylor will sich, wie alle Deduktionisten, mit allem immer auf sicherem Boden bewegen. Er will immer sagen können: Seht her, so ist es, ich beweise es euch hier, mit Beispielen und mit Argumenten!
Dadurch geschieht etwas eigenartiges: einerseits scheint der Deduktionismus eine sehr bescheidene Methode zu sein, denn er leitet ja nur etwas her, ohne etwas zu behaupten, jedenfalls gibt er sich diesen Anschein. Andererseits begründet aber gerade dieses „nur Herleiten“ eine Apodiktizität, die sich spätestens dann als unhaltbar herausstellt, wenn auch andere etwas „nur herleiten“, allerdings etwas völlig anderes, gegenteiliges.
Ich sehe einen Haufen von Problemen im Deduktionismus, ich sehe ihn geradezu als eine Geissel des originär-originell-verantwortungsvollen Denkens. Sicher nicht die einzige Geissel, die Phantasiererei mancher anderer Traditionen (ich verzichte auf Spezifisches, ein andermal) ist nicht besser. Aber schon die Tatsache, dass die scheinbar sicherste, scheinbar bescheidenste Methode indirekt die grösste Überheblichkeit mit sich bringt, nämlich den (Schein-)Anspruch der Apodiktizität, ist meiner Ansicht nach Grund genug, gegenüber dem Deduktionismus skeptisch zu sein. Abgesehen davon dass er, Entschuldigung, zu zu langatmigen Texten führt. Auch das Denken braucht Rhythmus, die Ableitungs-Manie zerstört ihn.
Was kann man da tun? Das philosophierende Subjekt muss als solches stärker in Erscheinung treten. Ja, es muss das, und es darf das. Denken tut immer ein Denker, eine Denkerin, eine Denkender, ein denkendes Subjekt. Wie weit dessen Gedanken über dieses eigene Subjekt hinaus Gültigkeit haben können, kann das denkende Subjekt selbst nicht beurteilen, es hängt auch nicht von ihm ab, sondern von den anderen. Denken ist ein Vorschlag, den ein Denkender macht. Es gehört, im Deduktionismus, zum guten Ton, dass dieser Denkende so tut, als gebe es ihn nicht, aber das ist ein Spiel, das sich gegen sich selbst richtet.
Und nun wollte ich ja heute zweimal über Taylor schreiben, der zweite Taylor ist der des Stücks „Bedeutungstheorien“, das ja auch eigentlich gerade viel mehr in meine Themen hineinpasst. Das verschiebe ich jetzt aber noch.
PS: Hier ein schöner, kurzer Artikel von Charles Taylor (2005) zu einem ganz anderen Thema: Kapitalismus. „Ohne den Kapitalismus können wir nicht leben (denn marktförmige Beziehungen durchdringen die Gesellschaft auf vielen Ebenen), aber mit ihm können wir es kaum aushalten.“
︎︎︎
Lächerlich!
16.09.
Lächerlich. Der Mensch ist kein Tier. Genauso wie der Schwanz kein Rücken und der Rücken kein Kopf ist. Kontinuitäten wachsen sich zu Distinktionen aus.
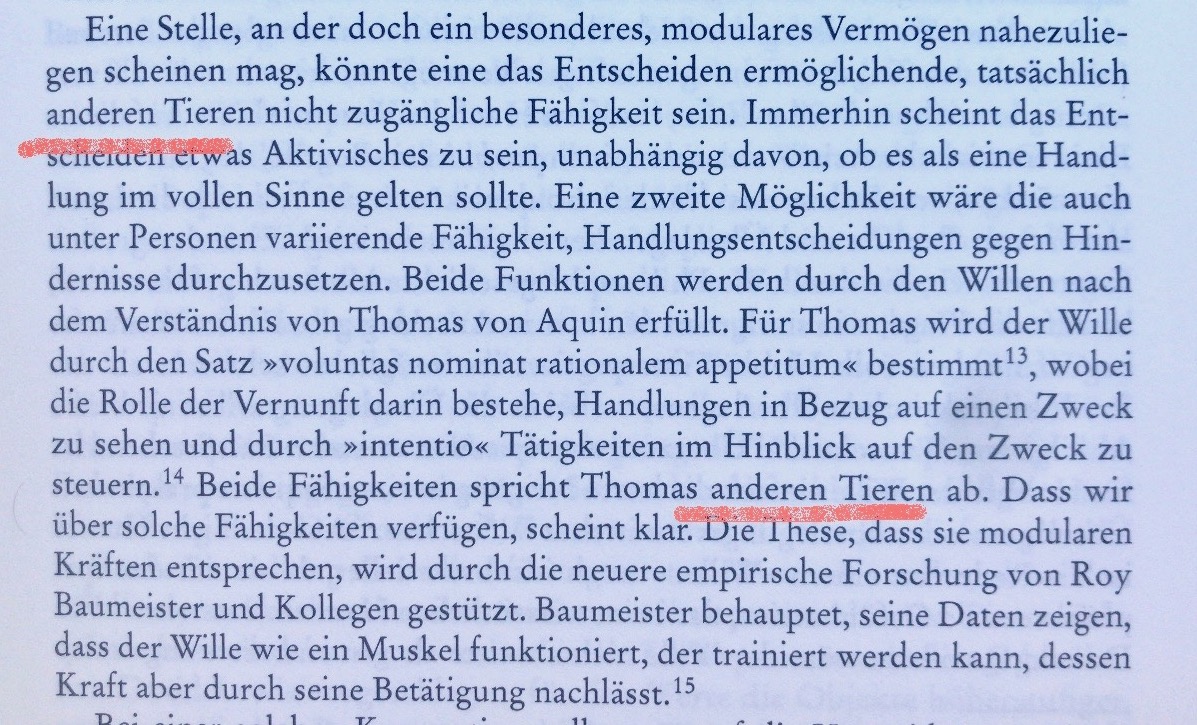
(aus: Wollen: Seine Bedeutung, seine Grenzen, Münster 2016, Vorwort. N. Roughley, J. Schälike)
Der Mensch ist auch ein Tier, aber nicht vor allem.
Besonders lächerlich ist, dass die Denkweise „Menschen und andere Tiere“ hier implizit Thomas von Aquin zugeschrieben wird. Seine Auffassung zum Verhältnis von Mensch und Tier ist komplex (und nicht widerspruchsfrei), aber sie lässt sich sicher nicht in eine moderne Terminologie(-option), die den Menschen als Tier unter Tieren sähe, übersetzen.
Thomas hat einerseits den Begriff homo (Mensch), andererseits animal (am ehesten: Sinnenwesen, ggf. auch „beseeltes Wesen“) und schliesslich brutum, das vernunftlose Tier. Der Mensch fällt auch unter die Sinnenwesen, ist aber – wie bei Artistoteles – ein vernünftiges Sinnenwesen mit „Verstandesnatur“. Man kann also unmöglich Thomas’ animal mit dem modernen englischen animal oder eben dem deutschen Tier gleichsetzen.
Zudem ist die menschliche Seele bei Thomas unsterblich, während die tierische Seele mit dem Tod vergeht, ausserdem sagt Thomas, dass der Mensch das Tier zum Instrument machen dürfe, weil es ihm ontologisch und der Schöpfungsordnung nach untergeordnet ist (er hat, glaube ich, auch noch biblische Argumente dafür). Ein Tier zu töten ist für Thomas keine Sünde. All das macht die kategoriale Trennung deutlich, die bei Thomas zwischen Mensch und Tier besteht.
Eine moderne Auffassung darf natürlich nicht die von Thomas oder gar von Descartes, der Tiere überhaupt als Automaten betrachtete, reproduzieren. Sie muss aber auch nicht ins Gegenteil verfallen und eine totale Fraternisierung und Egalisierung des Menschen mit den Tieren anstreben.
Natürlich geht es heute immer um ein verantwortungsvolles Verhältnis zwischen Mensch und Tier, und das Subjekt dieser Verantwortung kann nur der Mensch sein.
(OK, bei nochmaligem Durchschauen: Ich lesen den obigen Auschnitt vielleicht ein wenig böswillig. Die Autoren haben möglicherweise darauf gesetzt, dass ihre Leser mit der Problematik des begrifflichen Verhältnisses von Thomas’ animal und dem modernen Tier vertraut sind und gewissermassen selbst eine stillschweigende Bedeutungskorrektur ausführen. Vielleicht verdächtige ich sie zu unrecht, die Thomas’sche Unterscheidung zwischen Mensch und Tier verwischen zu wollen.
Dennoch: Wie liest man diese Sätze heute standardgemäss? Doch wohl so, dass sie implizieren, der Mensch sei Tier unter Tieren – full stop. Eine gutgemeinte Sichtweise, vor allem in Hinblick auf das problematische Verhältnis zwischen Mensch und übriger Natur, aber auch eine sentimentalistische und aktivistische.
Sicher sind existenziale Zusammengehörigkeitsgefühle von menschlicher Seite dem Tier gegenüber angebracht, aber sie dürfen nicht Unterscheidungen eliminieren, die letztlich sogar Voraussetzungen dafür sind, das begründete Zusammengehörigkeitsgefühl zu operationalisieren, also das gemeinsame ökologische Schicksal von Mensch, Tier und anderen Lebewesen zu managen.) ︎︎︎
Monsieur Péguy und die gut gemachte Arbeit

17.09.
Ein anderes Buch im Gepäck, ein anderer Charles, gestern und heute gelesen. In Bruchstücken erst einmal.
Und die Theoretiker der Klarheit schreiben trübe Bücher.
Hier habe ich mir den ersten grossen Marker drangeklebt. Denn es formuliert kurz und scharf einen Verdacht, um den ich schon lange herumdenke, nämlich: Die Forderung nach Klarheit und Deutlichkeit, die nicht nur von Descartes, sondern auch vom aktuellen Ideal der Wissenschaftlichkeit ausgeht, ist – nicht immer, aber immer wieder – selbstverfehlend. Wie ein Pfeil, den man aufs Ziel schiesst, aber er kommt da nicht an. Nicht, weil man schlecht schiesst, sondern weil die Beschaffenheit des Raumes, durch den er fliegt, ein Ankommen nicht erlaubt. Es findet eine Ablenkung statt, der auf die Klarheit zielende Pfeil landet, weil er auf die Klarheit zielt, immer im Unklaren.
Ich lese es natürlich relativ frei vom Kontext, vielleicht hat Péguy etwas etwas sehr Konkretes gemeint, konkrete „Theoretiker der Klarheit“, ich vermute das. Der Satz steht bei ihm in einem Zusammenhang – aber er bricht diesen Zusammenhang auf, als hätte er ihn dazwischenmontiert – der heute grösste Aktualität hat: Péguy beklagt, dass, wenn man von einer Sache spricht, man mit dieser Sache identifiziert wird.
Sobald ein Autor über einen christlichen Stoff arbeitet, machen wir aus ihm einen Christen; schreibt er aus einer tiefen Unordnung heraus, machen wir aus ihm einen Wiederhersteller der Ordnung [...]
Er zählt noch mehr solche Beispiele auf. Eine Spielart dessen, was heute oft unter „Kontaktschuld“ firmiert: Wenn man sich zu nah an etwas in irgendeiner Hinsicht Zweifelhaftes heranbegibt, sei es auch nur aus analytischen Interessen oder aufgrund einer Ambivalenz, mit der man sich auseinandersetzen möchte, entsteht die Wahrnehmung, man sei von diesem Etwas bereits vereinnahmt worden.
Das ist mir nur allzu gut vertraut, gerade in Hinblick auf die Religion (wenn ich meine Sympathien ihr gegenüber äussere, meint man bereits, ich sei ein Gläubiger und könne sicher kein Atheist sein, der ich aber bin), aber auch, wenn es um Politik geht, etwa um Realismus in den internationalen Beziehungen (statt Liberalismus – in den beiden jeweiligen spezifischen Bedeutungen, die diese Wörter in diesem Kontext haben) oder um Konservatismus.
Versäumt man es, ständig und ausdrücklich zu verstehen zu geben, dass man sich derartigen Themen „kritisch“ oder „dekonstruierend“ (was gemeinsam eigentlich heisst: abschätzig) nähert, dann wird man als ihr Vertreter oder Parteigänger einkategorisiert. Wie falsch, wie schädlich. Ich möchte ja vielleicht nur sagen: Dies und das finde ich gut an der entsprechenden Erscheinung, dies und das schlecht, und jeweils auch: warum, und natürlich empfinde ich demgegenüber, was ich gut finde, Sympathie und werde die auch äussern. Aber davon bin ich ja kein Christ, Konservativer oder Realist (wobei ich es beim letzten sicher teilweise wirklich bin).
Mir erschien dieses identifikatorische Missverstehen immer als eine Krankheit, die sich erst in den letzten Jahren ausgebreitet hat, eine akute grassierende Entzündung des hermeneutischen Apparates, aber sie hat offenbar zu Monsieur Péguys Zeiten auch schon existiert.
*
Ich habe Péguy irgendwann schon einmal zu lesen begonnen, auch hier in der Schweiz, aber auf Französisch und auch keinen Essay, sondern Lyrik. Ich glaube, es waren welche der Tapisseries, aber ich kann mich an nichts erinnern ausser daran, dass der Text in der Tat sehr verwirkt war, im Sinne einer extrem engen Fadenbindung, ich habe damals keinen Zugang gefunden. Ich wusste aber, dass Péguy als konservativ galt, sogar als schrecklich konservativ, und dass er ein wenig eine verbotene Frucht war, um die man einen Bogen macht, wenn man nicht gerade ein katholischer Fundamentalist ist, von der man auch nicht viel lernen konnte. Das Gegenteil von einem Avantgardisten, für den man hätte schwärmen können.
*
Ich fand Péguy jetzt, in diesem Text hier, auch tatsächlich krass konservativ und schüttelte beim Lesen mit dem Kopf und sagte laut vor mich hin: krass, worauf sich eine interessante Diskussion mit I. über Herkünfte, soziale Ordnung und soziale Durchlässigkeit anschloss, in der ich mehr und mehr zum Verteidiger einer „sozialistischen“ Sichtweise wurde, einer Sichtweise, die die Verantwortung für das Ergehen eines Menschen eher in den Umständen lokalisiert als bei ihm selbst –
Péguy jedenfalls schwebt eine Welt vor, in der der Handwerker Handwerker, der Lehrer Lehrer, der Pfarrer Pfarrer ist usw. Was er skizziert und in der Skizze idealisiert, ist eine Welt des Mittelalters, eine Welt der Stände, eine Welt der ordo. Für ihn ist das eine christliche Welt und das Christentum eine Art von Antike, neben der es sonst nur die andere Antike gibt, die Hebräische, und dann die Moderne.
In dieser Ordnung steht nicht der Mensch im Zentrum, sondern das Werk. (Und erst recht nicht das Geld, das dem Aufsatz den Titel gibt und gegen das, oder gegen dessen Universalisierung, die Universalisierung des Monetären, Péguy aufbegehrt.)
Ich musste die ganze Zeit, überhaupt den ganzen Aufsatz hindurch, an Saint-Exupéry denken. Auch so eine alte Lektüre, an die ich nur vage Erinnerungen habe: La Citadelle, deutsch Die Stadt in der Wüste. Es gibt da eine Gedankenfigur: dass ein Mensch sich im Laufe seines Lebens gegen sein Werk austauscht, und dass er deshalb dieses Werk gut tun will. Es ist schliesslich das, was von ihm übrigbleibt, es ist das, wozu er wird. Ich habe mir das immer als ein Hinüberwachsen in etwas vorgestellt, und nach dem Tod ist dann nur noch dieses Etwas da, anstelle des Ich, die Verwandlung ist vollendet.
Was Péguy im Sinne hat, wenn er davon spricht, dass „früher“ die Menschen in einem anderen Verhältnis zu ihrem Werk standen – seine Beispiele handeln fast immer von Handwerkern, er ist selbst aus einer Handwerkerfamilie, sein Vater (früh verstorben) war Tischler, seine Mutter Stuhlflechterin – was er also im Sinn hat, wenn er von den Menschen „früher“ und ihrer Arbeit, ihrem Werk spricht, scheint etwas ähnliches zu sein wie das Sich-Austauschen von St.-Exupéry. Bei Péguy geht es dabei immer wieder um das Mittelalter, um die Kathedralenbauer: Dass die Arbeit selbst dort gut gemacht ist, wo man sie nicht sieht, dass es für die Handwerker unvorstellbar gewesen wäre, sie nicht gut zu machen, dass sie vor Ihrer Arbeit Achtung empfanden, vor den Meistern dieser Arbeit erst recht, dass mit einer Art von Sportsgeist alle darum eiferten, so gut wie möglich zu arbeiten, dass nicht der Erwerb im Vordergrund stand (der war in Péguys Vorstellung sowieso „irgendwie“ gesichert), dass die Vorstellung, auf der Baustelle zu sein, um schlecht zu arbeiten, eine unmögliche, eine unvorstellbare Vorstellung war ...
Um Péguys Verhältnis zum Sozialismus nachvollziehen zu können, fehlt mir ein wenig vom zeitpolitischen und auch vom biographischen Hintergrund. Wie ich verstanden habe, war er eigentlich Sozialist, aber auch wieder mit den Sozialisten zerstritten. Durch den ganzen Text geistert jedenfalls der Vorwurf, in der neuen, modernen Zeit, die einerseits sozialistisch, andererseits bürgerlich (bourgeois) sei – gemeint damit ist die Dritte Republik, nach der Niederlage 1870 im Deutsch-Französischen Krieg (-> Bismarck), folgend auf das Zweite Kaiserreich (Napoleon III., seit 1852), dem wiederum die zweite Republik vorausging (nach der Februarrevolution 1848) –
Durch den Text also geistert der Vorwurf, in der laizistischen, modernistischen Dritten Republik würden die Arbeiter auf die Baustelle gehen, um nicht oder um schlecht zu arbeiten und um sich durch Streiks höhere Einkünfte zu erzwingen, allerdings für immer weniger Getanes und immer schlechter Getanes, da sie anstatt der Achtung für das Werk nunmehr einer anderen Logik folgen, nämlich der Logik des Geldes (daher der Titel). Und diese Logik haben sie übernommen von der „bourgeoise“ bzw. diese hat sie ihnen, den Arbeitern, aufgedrängt im Glauben, damit etwas für den „Fortschritt“ zu tun – es gibt da diese Stelle im Text:
Die politische Partei der Sozialisten besteht ausschliesslich aus bürgerlichen Intellektuellen. Sie haben die Sabotage und die doppelte Desertion erfunden: die Fahnenflucht vor der Arbeit und die Fahnenflucht vor dem Werkzeug.Und da ist Péguyis Polemik wieder bei etwas, das auch heutige Konservative den heutigen Progressiven vorwerfen: Dass sie verzogene Sprösslinge der hypersaturierten Gesellschaft sind, die sich zu Advokaten der Entrechteten machen, die sich selbst aber gar nicht für solche halten. Die Überprivilegierten glauben irgendjemand anders einreden zu müssen, diese anderen seien unterprivilegiert, um sich selbst, den Überprivilegierten, einen Lebenssinn zu geben. So ist es natürlich nicht. Aber ein bisschen schon. Dazu passend auch, bei Péguy:
Die Männer der französischen Revolution waren Männer des Ancien Régime. Sie spielten die Französische Revolution. Aber sie waren vom Ancien Régime.
*
Armut. Péguy sieht nichts Schlechtes in der Armut, nichts, das man bekämpfen müsste, die Armut an sich ist überhaupt ausserhalb von gut und schlecht, ein Mensch kann in der Armut würdevoll leben und vielleicht überhaupt nur in ihr.
Einerseits klingt das zynisch. Andererseits spiegelt sich darin christliches Denken (nicht unbedingt christliche Praxis): Péguy spricht da als ein fast archaischer, fast fundamentalistischer Christ, fast möchte man ihn in einen Heuwagen der Amish setzen. Armut als Erlösung.
Was er hingegen als ein schweres Übel ansieht, ist Elend. Aber Armut und Elend sind für ihn ganz unterschiedliche Dinge.
Es gibt da diese Reflexion, dass man sehr wohl versuchen kann, der Armut „nach oben“ zu entkommen, und dass das auch gelingen kann, dass man sich aber dann nicht wundern darf, wenn man statt dessen ins Elend abstürzt. Wer in der Armut bleibt, dem kann das nicht geschehen, der ist vor dem Elend gefeit. Die Armut gibt Sicherheit und Geborgenheit:
Mit der Annahme der Armut ging eine Art Diplom einher, eine Art Vertrag. Der Mensch, der sich entschieden in die Armut fügte, war niemals ein in seiner Armut Verfolgter. Sie war ein Refugium. Sie war ein Asyl.
Das ist natürlich ein Standesdenken, wie überhaupt sein ganzes Bild der Gesellschaft eines der Stände ist und eines der Ungleichheit. Das ist der Gedanke der Gesellschaft als Organismus aus ungleichen Gliedern, wie er zum konservativen und „rechten“ Denken dazugehört.
Natürlich kann man ihn leicht angreifen, weil er das humanistische Gleichheitsgebot verletzt. Aber andererseits ist eine Gesellschaft nur aus Gleichen, eine homogene, ganz und gar egalitäre Gesellschaft tatsächlich kaum vorstellbar, und man fragt sich, wie sich das grössere Mass an Würde für jeden einzelnen erreichen lässt, dadurch, dass alle nach etwas streben, das sie nie erreichen werden (auch der Reiche nicht), oder dadurch, dass man lernt (oder nie ver-lernt), sich mit etwas zu bescheiden. Die Frage ist sicher noch nicht letztgültig entschieden. Und es wäre unredlich zu sagen, dass nur der sie überhaupt aufwirft, der Privilegien zu verlieren hat, denn vielleicht würde er sie sogar gerne abgeben, wenn er dadurch Würde gewänne. Péguy jedenfalls verteidigt die Würde des Armsein als Armer (der Herkunft nach, und auch später scheint er nicht reich geworden zu sein).
Noch Zitate:
Ein Mensch bestimmt sich nicht durch sein Tun und noch weniger durch das, was er spricht. Ein Wesen wird im Innersten ausschliesslich dadurch bestimmt, was es ist.
Essentialismus. Der als grundsätzlicher Denkansatz, allen anti-essentialistischen Bestrebungen zum Trotz, nicht aus der Welt zu schaffen ist. Und sei es nur, weil die Fiktion eines „Wesens“ aus pragmatischen Gründen unersetzlich ist (was ist die „Identität“ anderes als ein „Wesen”?).
Ein Mensch bestimmt sich durch seine Wurzeln, durch seine Herkunft.
Hier wieder der „krasse“ Konservativismus.
Er wird nicht durch das bestimmt, was er für andere, für seine Nachfolger tut. Vielleicht werden die anderen, die Nachfolger, daraus gemacht sein. Aber er ist nicht daraus gemacht.
Kontinuität, akkumulierte Tradition. Auch hier deutet sich eine Gedankenfigur des Sich-Verwandelns, Sich-Austauschens an. Interessant, dass Péguy von „Nachfolger“ spricht, nicht von „Nachkommen“. Er fomuliert es sehr offen.
Angesichts des Konservativismus: Dass jetzt auch Linke Péguy lesen und sich auf ihn berufen, angeblich etwa Badiou, erstaunt mich da. Andererseits ist die Kritik an der Ökonomisierung oder Monetarisierung natürlich auch ein linkes Thema. Ich möchte nicht „Querfront“ sagen, aber es gibt immer wieder mehr Verwandschaften zwischen rechts und links, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.
*
Eine interessante Dialektik hat Péguy mit den Metaphysiken. Wenn man es denn Dialektik nennen will.
Es geht ja in dem Text, jedenfalls wenn man nach den Text-Volumina schaut, vor allem ums Bildungssystem. Noch etwas, wo mir die Zeitpolitik fehlt, auch wenn ich es ein wenig rekonstruiert habe, aber es ist mir jetzt nicht so wichtig. Das Schulsystem wurde reformiert, dabei auch die Trennung von Staat und Kirche durchgesetzt, das alles steht in Zusammenhang mit der Dreyfus-Affaire. Péguy war gegen die Schulreform, aber in der Dreyfus-Affaire früh auf Seiten von Zola (J’accuse…!).
Bei den Metaphysiken geht es um seine eigene Kindheit und Schulzeit. Allerdings nicht nur. Péguy sagt, jeder habe eine Metaphysik, aber nicht jeder gebe es zu (oder nicht jeder wisse es?). Das denke ich auch. Der Anspruch, „die Metaphysik loszuwerden“, ist nicht durchzuhalten, denn natürlich führt er zu einer neuen Metaphysik, die allerdings vielleicht in anderem Gewand auftaucht, die nicht mehr in den Narrativen steckt, sondern in den Begriffen oder in den Methoden. Aber sie ist da. Wie es keine Standpunktlosigkeit gibt, gibt es auch keine Metaphysiklosigkeit.
Eine Metaphysik – das sind die allgemeinsten impliziten (nicht explizierbaren) Prämissen. Und natürlich hat jeder Mensch und jedes Denken welche. Insofern ist die Dekonstruktion, auch wenn sie viel Interessantes hervorgebracht hat, gescheitert, bzw. war ihr Programm von Anfang an blauäugig (ja, mehr blau- als schlitzäugig).
In seiner Schulzeit, sagt Péguy, hat er zwei Metaphysiken aufgesaugt, die der Grundschullehrer und die der Priester, und natürlich waren es zwei Metaphysiken, die einander vollständig ausschlossen, und dennoch lebten sie beide in ihm weiter ... – ich muss nachsehen, wie das war.
*
18.09.
Das Werk, sein Werk gut machen wollen, Achtung vor dem Werk als Werk empfinden, sich austauschen gegen sein Werk: Das hat natürlich auch Anklänge an die Qualität von Robert Pirsig (in Zen and the Art of Motorcycle Maintenance). Bei allen dreien – Péguy, Saint-Exupéry, Pirsig – geht es darum, der Qualität einer Arbeit einen Wert an sich zuzuweisen, also einen Wert, der kein Tauschwert ist, und immer hat dieser Wert eine metaphysische, „transzendente“ Dimension. („Transzendent“ in Anführungsstrichen, weil ich mit dem Wort Probleme habe.)
Es ist auffällig, dass diese Thematiken von Autoren aufgeworfen werden, die eher Schriftsteller sind als systematische Philosophen. Liegt das an den Thematiken selbst? Eignen sie sich grundsätzlich nicht dazu, systematisch reflektiert zu werden? Oder liegt es an der Disziplin Philosophie – hat sie sich aus irgendwelchen Gründen derart verschoben, dass sie diese Themen, die eigentlich in sie hineingehören würden, nicht mehr aufnehmen, nicht mehr „akkomodieren“ kann?
*
Péguys dialektische oder jedenfalls antiverse (einander entgegengerichtete) Metaphysiken. Jeder hat eine Metaphysik. Offenkundig, versteckt. [...] Die Metaphysik unserer Grundschullehrer, das war [...] die Metaphysik der Wissenschaften, es war die oder zumindest eine Metaphysik des Materialismus [...], es war eine positivistische Metaphysik, es war die berühmte Metaphysik des Fortschritts. Die Metaphysik der Pfarrer, mein Gott, das waren eben die Theologie und auch die Metaphysik, wie sie sich im Katechismus fanden.
Unsere Grundschullehrer und unsere Pfarrer, das wäre ein ziemlich guter Romantitel. Unsere laizistischen Grundschullehrer hatten eine bestimmte Art der Unterrichtung, eine bestimmte Metaphysik. Unsere [...] Pfarrer, hatten und gaben eine bestimmte Unterrichtung, die dem diametral gegenüberstand, eine entgegengesetzte Metaphysik. Wir bemerkten das nicht, und ich muss das nicht wiederholen und es ist auch nicht das, was ich sagen will. Was ich sagen will, das ist viel ernster.
Und dann folgt eine seltsame Reflexion, eine seltsame Figur, die sich nicht ohne weiteres ausloten lässt.
In der Kindheit, sagt Péguy, hätten sie beiden Metaphysiken gleichermassen geglaubt (obwohl sie miteinander unvereinbar sind), der wissenschaftlichen wie der religiösen (er nennt es katholischen). Heute aber sei die wissenschaftliche Metaphysik der Grundschullehrer in ihnen (oder in ihm, in Péguy?) „weniger als kalte Asche“, während sie (er?) von der religiösen Metaphysik der Pfarrer „vollständig durchtränkt“ seien. Andererseits – und darin liegt das Kaum-Auslotbare – hätten „unsere Grundschullehrer unser ganzes Herz und unser Vertrauen behalten”, während man von den alten Pfarrern nicht behaupten könne, „dass sie unser ganzes Herz, noch, dass sie unser Vertrauen hatten“.
Die weltliche Lehre ist also verblasst, während das Vertrauen in ihre Vermittler geblieben ist (die Vermittler sind integer, oder sie sind „welche von uns“, so würde ich es lesen); die religiöse Lehre hingegen geblieben und sogar aufgeblüht, während diejenigen, die sie vertreten, damals so wenig integer schienen wie heute (sie sind nicht „unsere Leute“, sondern „andere“).
Die Doktrinen stehen nicht nur im Widerspruch miteinander, sie stehen mit ihrem jeweiligen Ethos überkreuz! Das ist in der Tat eine bemerkenswerte, wenn nicht fatale Konstellation.
Bei Péguy geht es dann weiter:
Es gibt hier ein Problem, ich würde sogar sagen ein Mysterium, ein sehr ernsthaftes. Machen wir uns nichts vor: Es ist genau das Problem der Entchristlichung Frankreichs. Man verzeihe mir diesen etwas feierlichen Ausdruck.
Da ist man wieder bei Péguys Ablehnung der Dritten Republik, seinem Widerstand gegen die Laizisierung usw. – man darf überhaupt nicht vergessen, dass der Text 1913 geschrieben ist, dass es ein Text unmittelbar vor dem Ende des alten Europa ist (und vor Péguys Ende, der 1914 in der Marne-Schlacht fiel, von Deutschen erschossen wurde) – aber für mich hat diese Figur eine viel überzeitliche Lesbarkeit, eine längerfristige Bedeutung.
Zum einen durch die Konstellation der beiden Metaphysiken, der wissenschaftlichen (positiven, empiristischen ...) und derjenigen, die ich jetzt lieber poetische Metaphysik nennen möchte (zuvor „religiöse“, bei Péguy „katholische“). An dieser antiversen, diametral widersprüchlichen Konstellation hat sich bis heute nichts geändert, auch wenn die poetische Metaphysik heute wesentlich weniger sichtbar ist, als es die katholische in Péguys Frankreich gewesen sein muss.
Aber auch am Kreuzstand Doktrinen / Ethos hat sich nichts geändert, jedenfalls nicht für mich. Meine Leute sind auch heute die aus der Wissenschaft, die Säkularen, die Progressiven. Fast alle meine Freunde gehören zu dieser Gruppe, zu dieser Metaphysik, und wenn ich mich auf mein menschliches Sympathie-Rezeptorium verlasse, dann führt es mich mit wenigen Ausnahmen zu Leuten dieser Metaphysik hin. Und dennoch kritisiere ich sie – nicht die Menschen, sondern ihre Doktrin! Denn sie sitzen dem Fehler auf, die andere Seite nicht wahrzunehmen, die doch in der Tat eine andere Seite derselben Medaille ist – nämlich die poetische Seite, die poetische Metaphysik.
Von wem die heute vertreten oder verkörpert wird, fällt mir schwer zu sagen. Das ist ein Problem für sich, denn wir verwechseln das Poetische mit dem Religiösen (und werfen, da wir das Religiöse mit gutem Grund verabschiedet haben, das Poetische gleich mit heraus, allerdings ganz ohne Grund). Aber wenn ich danach schaue, was einer poetischen Metaphysik (die in einem antiversen Verhältnis zur einer wissenschaftlichen steht) am nächsten kommt, dann stosse ich fast immer auf Leute, mit denen ich meist nicht in einem Boot sitzen möchte, entweder auf Nostalgiker, oder auf Sentimentale, oder auf krass Konservative ... Ihr Stil ist nicht meiner. Ihr Stil ist meinem gegnerisch. Und le style, c'est l'homme, in diesem Falle wirklich.
Das ist ein riesiges Thema, und es spiegelt sich unter anderen in dem Ort, in oder neben dem ich dies jetzt schreibe, Fribourg, mit seiner Mischung aus (architektonischer) Moderne (Denis Honegger) und leicht angestaubter Transzendenz – die mich schon zu Studienzeiten auf eine halbbewusste Art und Weise fasziniert hat und die ich immer noch vielversprechend finde. Aber darüber will ich jetzt nicht schreiben. Weiter Péguy:
Unsere alten Grundschullehrer waren nicht nur Männer des alten Frankreichs. Sie lehrten uns im Grund die Moral und das Wesen des alten Frankreichs. Ich werde Sie jetzt überraschen: Sie lehrten uns das Gleiche wie die Pfarrer. Und die Pfarrer lehrten uns das Gleiche wie sie. Alle ihre metaphysischen Gegensätze hatten kein Gewicht angesichts jener tiefen Gemeinschaft derselben Substanz [...]
Unvereinbar, diametral einander gegenüberstehend, und dann doch eine „tiefe Gemeinschaft derselben Substanz“ – ist das cusanisch, als coincidentia oppositorum? – vielleicht hat es etwas davon, aber vor allem ist es das, was ich mit Dialektik meinte, in einem Hegelschen Sinne der Negation der Negation ...
*
Diese Arbeiter dienten nicht. Sie arbeiteten. Sie hatten eine Ehre, die absolut war, wie es der Ehre zu eigen ist. Ein Stuhlbein musste gut gemacht sein. Das war selbstverständlich. Das hatte Vorrang. Es musste nicht gut gemacht sein für das Gehalt oder um das Gehalt zu rechtfertigen. Es musste nicht gut gemacht sein für den Chef oder für Kenner oder für die Kunden des Chefs. Es musste aus sich selbst gut gemacht sein, in sich selbst, für sich selbst, in seinem Wesen selbst. [...] Alle Teile des Stuhls, auch die, die man nicht sah, waren genauso perfekt gemacht wie die, die man sah. Es war ein und derselbe Grundsatz. Wie bei den Kathedralen.
Diese Metaphysik der Qualität (so nennt es Pirsig) ist für mich das geistige Zentrum des Textes. Nicht die Nostalgie, nicht das Reaktionäre, nicht die Ungleichheits-Ordnung der Gesellschaft (die als ein Organismus des Unterschiedlichen gedacht ist).
Aus unserer gestrigen Diskussion: Das Industrieprodukt verweigert diese Art von Qualität. Diese Qualität ist eine Qualität des Handgemachten, eine Qualität der Manufaktur, des Artisanalen. Was von Maschinen hergestellt wird, in gewaltiger Stückzahl, kann diese Qualität nicht haben. Und es geschieht derzeit eine Neubewertung solcher Qualität des Werkes: in den craft-Bewegungen (craft beer), im Auftauchen der kleinen Manufakturen für Lebensmittel oder für Bedarfsprodukte wie Schuhe. Allerdings aus einer ganz anderer Schicht heraus als der der heutigen Handwerker – eher aus der hipster-Schicht heraus, der urbanen, der gebildet-„kreativen“.
Was bedeutet das? Wird das Handwerk neu erfunden, neu geschätzt, erst in einer gentrifizierenden Bewegung, die dann möglicherweise auch wieder den Weg findet von den Metropolen in die Provinzen, von den Studierten zu den Ausgebildeten?
Und stimmt es überhaupt, dass eine industrielle Fertigung diese Art von Qualität nicht hervorbringen kann? Sicher, ein Roboter tauscht sich nicht aus gegen sein Werk. Er kann ja ewig leben, wenn ihn nicht jemand irgendwann zerlegt. Aber von der Seite des Produkts her kann man sich eine Perfektion aller Teile, selbst derer, die man nicht sieht, wohl vorstellen. Ihr „metaphyischer Geist“ läge dann allerdings nicht im Computer sondern in dem, der ihn programmiert, und der auf die Qualität des Werkes einen solchen Wert legt. Und dann gelangt man zu der Vorstellung, dass sich Programmierer und Programmiererin gegen ihr Werk ausgetauscht haben ...
Ausserdem:
Eine Zeitschrift lebt nur dann, wenn sie in jeder Nummer ein gutes Fünftel ihrer Abonnenten verärgert. Die Ausgewogenheit besteht darin, dass es nicht immer dieselben sind, die sich in diesem Fünftel befinden.
Zu beherzigen! Und:
Lippen wie ein Warenautomat.
Grossartig. Es geht um verbitterte alte Professoren an der Sorbonne. Aber das Bild trifft stets, wo jemand Wörter konfektioniert herausgibt.
Was ich noch dachte: Es liest sich alles ein wenig trunken. Aber nicht wie das Delirium mancher russischer Autoren. Dafür zu wenig phantastisch und zu verantwortungs-visiert. Aber warm und etwas bösartig zugleich. ︎︎︎
